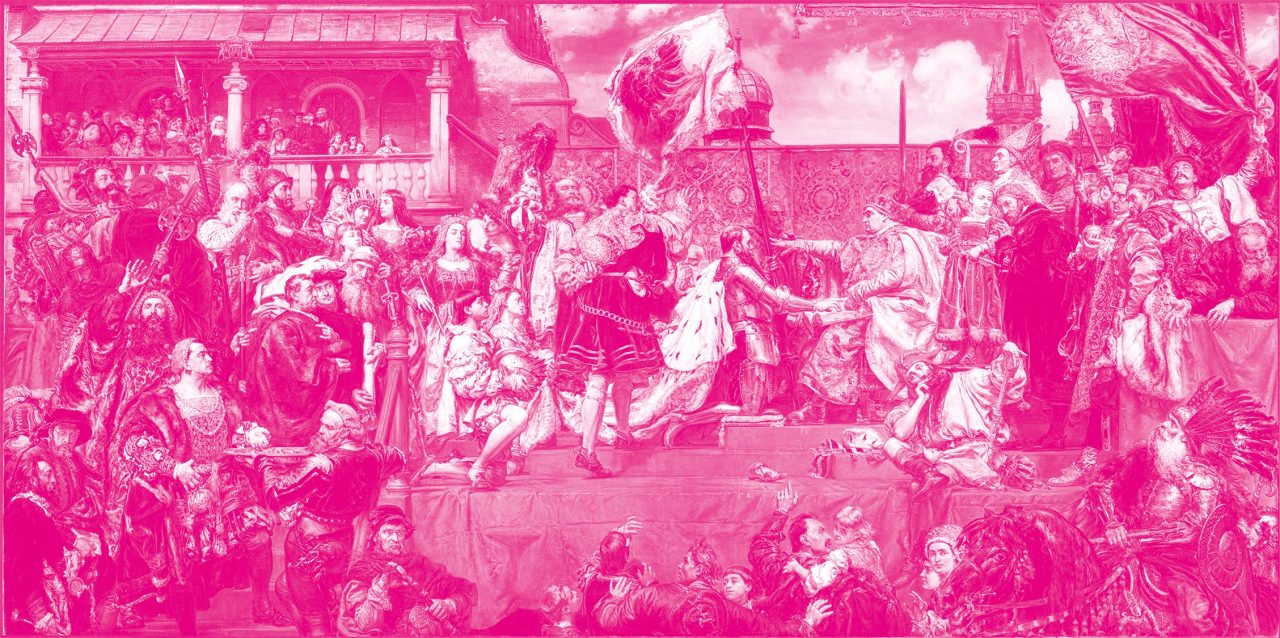Kein Preußen ohne Polen!
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('MMM') }}
{{ time.start_TS | TS2dateFormat('YYYY') }}
| 8 EUR, ermäßigt 4 EUR |
| Bitte buchen Sie Ihr Ticket vorab online oder an der Kasse im Foyer. |
| ab 14 Jahre |
| Deutsch |
| Saal 3, EG |
| Teil von: ORTS-Termin |
Vor 500 Jahren huldigte Albrecht von Hohenzollern, der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens, dem polnischen König. Damit wurde die Regierung der Hohenzollern über das neue Herzogtum Preußen begründet. Die Entstehung eines preußischen Staates sollte die deutsch-polnischen Beziehungen für die nächsten Jahrhunderte entscheidend prägen.
Im Rahmen einer Konferenz zum Gedenken an das Ereignis von 1525 befasst sich der ORTS-Termin mit den Auswirkungen dieser jahrhundertelangen Verflechtungsgeschichte von Polen-Litauen und Brandenburg-Preußen bis zur Zeit des Nationalismus und den neueren politischen Entwicklungen.
Welche Unterschiede gab und gibt es in der Bewertung von „1525“ in Deutschland und Polen? Lassen sich anlässlich des Jahrestages Aspekte dieser Beziehungsgeschichte hervorheben, die sonst kaum öffentlich präsent sind? Welche Bedeutung haben die Beziehungen der vormodernen multikonfessionellen Staaten Polen-Litauen und Brandenburg-Preußen für das gegenwärtige deutsch-polnische Verhältnis?
An einem zentralen Ort preußisch-polnischer Geschichte, dem Standort des historischen Berliner Schlosses, laden wir Sie zum Austausch mit Expert*innen aus Polen und Deutschland ein.
Das Gespräch wird moderiert von Dr. Judith Prokasky, Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss.
Prusy bez Polski nie żyją!
500 lat Historii Prus i Stosunków Polsko-Niemieckich
500 lat temu ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrycht z Hohenzollernów, złożył hołd lenny polskiemu królowi. Ustanowiło to panowanie Hohenzollernów nad nowym Księstwem Pruskim, które pozostawało pod zwierzchnictwem Królestwa Polskiego przez ponad 130 lat.
W ramach konferencji upamiętającej wydarzenie z 1525 r., dyskusja panelowa ‘wizyta na miejscu’ przyjrzy się skutkom wielowiekowej historii współzależności między Polską a Litwą oraz Brandenburgią i Prusami aż do czasów nacjonalizmu i nowszych wydarzeń politycznych.
Jakie były i są różnice w ocenie roku 1525 w Niemczech i w Polsce? Czy z okazji jubileuszu można podkreślić te aspekty historii stosunków, które w przeciwnym razie nie są publicznie obecne? Jakie znaczenie dla obecnych stosunków polsko-niemieckich mają relacje między nowoczesnymi wielowyznaniowymi państwami Polski i Litwy oraz Brandenburgii i Prus?
W centralnym miejscu prusko-polskiej historii, na terenie historycznego Pałacu Berlińskiego, zapraszamy na wymianę z ekspertami z Polski i Niemiec.
Beteiligte
Professor Dr. hab. Peter Oliver Loew ist seit 2019 Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt und Honorarprofessor an der Technischen Universität Darmstadt. Er wurde 2001 an der Freien Universität Berlin promoviert und habilitierte sich 2014 an der TU Dresden. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, Danzigs und Pommerns sowie der ostmitteleuropäischen Erinnerungskultur.
Professor Dr. Igor Kąkolewski ist seit 2011 Direktor des Zentrums für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin und außerordentlicher Professor an der Ermländisch-Masurischen Universität in Olsztyn. Er leitet die polnische Seite des deutsch-polnischen Geschichtsbuchprojekts Europa – Unsere Geschichte und war zuvor u. a. am Deutschen Historischen Institut Warschau tätig. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die polnische und europäische Geschichte der Frühen Neuzeit, die deutsch-polnischen Beziehungen sowie Erinnerungskulturen und Geschichtsdidaktik.
PD Dr. Maciej Ptaszyński ist Mitarbeiter am Historischen Institut der Universität Warschau und habilitierte sich 2019 nach Studien in Warschau, Berlin und Greifswald. Forschungs- und Lehraufenthalte führten ihn unter anderem nach Mainz und Frankfurt am Main. Seine Schwerpunkte liegen auf der Reformationsgeschichte, der Geschichte des Christentums in der Moderne und politischen Theorien der Neuzeit.
PD Dr. Agnieszka Pufelska ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nordost-Institut der Universität Hamburg (Lüneburg) und Privatdozentin an der Universität Potsdam. Die Kulturhistorikerin befasst sich mit der Geschichte der deutsch-polnischen Kulturverflechtungen und der modernen jüdischen Geschichte. Veröffentlichungen u.a. zu den Themen Antisemitismus, Geschichtsbilder und nationale Identitätskonstruktionen. Derzeit forscht sie zur Aneignung des preußischen Kulturerbes in polnischen Museen.
Partner

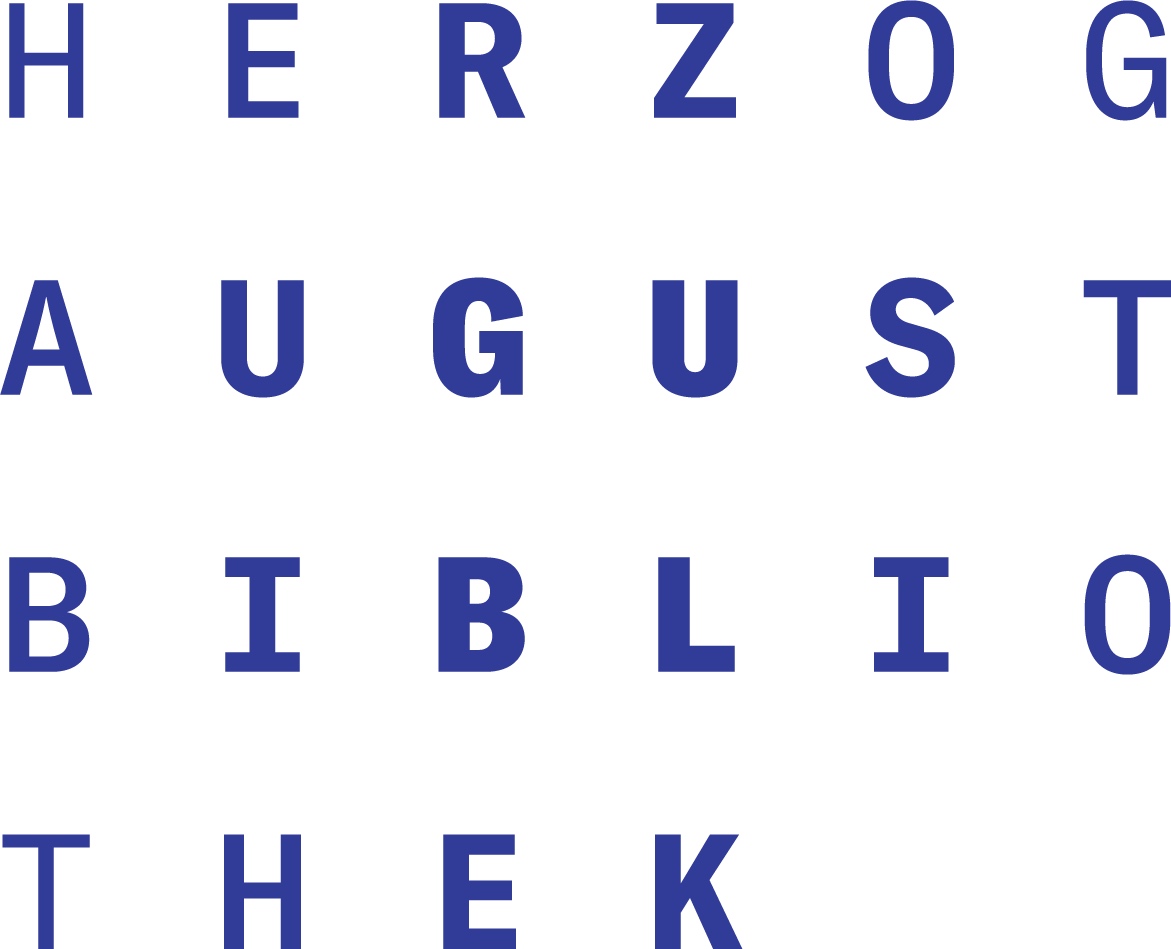

gefördert durch